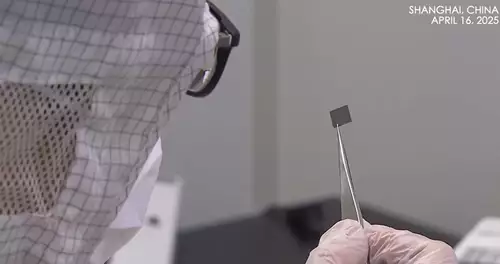...denn bei genauerem Hinsehen passen Sensorformat und Stauchfaktor erstaunlich selten exakt zueinander. Und liegt man in der Kombination weit daneben, bekommt man vielleicht nicht unbedingt die ersehnte Ästhetik.
Worum geht es?
Ein anamorphotisches Objektiv (kurz "Anamorphot") staucht das Bild horizontal vor der Aufzeichnung auf der Sensorfläche. Vor der Wiedergabe wird das Bild wieder entzerrt, wodurch die Proportionen im gezeigten Bild wieder stimmen. Das früher übliche 4:3 Kinoformat konnte damit besser ausgenutzt werden, weil man hiermit "mehr Breite" aufzeichnen konnte - was letztlich die Basis für das berühmte CinemaScope Breitbild-Format bildete.

Beim Einsatz eines Anamorphoten tauscht man eine geringere horizontale Auflösung gegen mehr Weitwinkel bei der Aufzeichnung und bekommt dabei spezielle Artefakte wie ovale Lensflares zu Gesicht- was viele DOPs heute als bildgestaltendes Stilmittel einer anamorphotischen Produktion sogar bewusst suchen.
Eine Frage der (Seiten-)Verhältnisse
Was sich mit einem anamorphen Objektiv ändert, ist also das Seitenverhältnis bei der Aufzeichnung. Diese so genannte Aspect Ratio bezeichnet das Verhältnis der Breite zur Höhe eines Bildes. Lange Zeit herrschte im Kino und Fernsehen ein typisches Seitenverhältnis von 4:3, bzw. 1,33:1. In diesem Format landeten die Einzelbilder auf analogem Film. Da man das Format des Filmes nicht ändern wollte oder konnte, nutzte CinemaScope anfänglich eine anamorphotische Komprimierung von 2:1. Diese verdoppelte das gängige Seitenverhältnis von 1,33:1 auf 2,66:1. Mit dem Einzug von Magnetstreifen als Tonspur wurde die Aspect Ratio des Bildes später auf 2,55:1 reduziert.
Mit der Digitalisierung der Displays und dem zeitgleichen Ende der Fernsehröhren erhielten Fernseher mit dem Einzug von HD ein deutlich breiteres 16:9 -Format (was 1,77:1 entspricht). Zugleich etablierte sich für die digitale Breitbild-Distribution das 21:9 Format. Dieses entspricht in der Praxis jedoch gar nicht dem rechnerischen Bruch (also 2,33:1) sondern typischerweise der Aspect Ratio von 64:27, also eher 2,37:1.
Raucht schon der Kopf? Fast egal, denn das klassische, analoge CinemaScope entwickelte sich zum Ende der analogen Zeiten ebenfalls noch weiter in Richtung 2,35:1, während der digitale, cinematische Breitbild-Content sich mit einer Aspect Ratio von 2,39:1 "entwickelte". Und dies wurde letztlich das nun gängigste Format, welches man heutzutage üblicherweise bei einer "Cinematic Widescreen" Produktion nutzt - und damit immer eine gute Wahl, sofern man so wenig Ärger wie möglich in der Distributionskette erzeugen will. In der 4K-DCI-Welt entspricht 2,39:1 meistens 4.096 x 1.716 Pixeln. Was wiederum nicht nur DaVinci Resolve als DCI-Default-WideScreen Projektgröße anbietet.
Wo gibt´s denn sowas?
Sieht man sich jedoch in der Kamerawelt um, so findet man kaum eine Kamera, welche diese Auflösung als natives Aufnahmeformat unterstützt. Nicht einmal nach einer rechnerisch korrekten Entzerrung in der Postproduktion. Was natürlich zum großen Teil daran liegt, dass man diese Auflösung meistens gar nicht mit einem 1:1 Sensor-Readout erzielen kann. Dank Oversampling zeichnet man sowieso in der Regel in einer höheren Auflösung als dem Zielformat auf - am besten mit einem ganzzahligen Vielfachen. Denn wer schon bei der Aufzeichnung ein zuverlässiges Framing wünscht, sollte natürlich im Kameradisplay klar sehen, in welchen Rändern man sich mit der Aspect Ratio exakt bewegt.
Doch das kann wiederum nur zuverlässig funktionieren, wenn die Kamera zur Vorschau zugleich eine anamorphotische Entzerrung bietet. Die meisten Kameras bieten hierfür jedoch keine manuelle, numerische Einstellung, sondern erlauben nur die Auswahl typischer Werte gängiger Objektive - meistens also 1,33x, 1,5x, 1,66x sowie 2x. Diese Werte beschreiben, wie stark das Bild im Objektiv gestaucht wird. Ein 2x Anamorphot verbreitert das aufgezeichnete Bild effektiv um das Doppelte. Ein 1,33x Objektiv wirkt dagegen eher subtil.
Sehen wir uns nun einmal in einer Tabelle die typischen Sensor- und Stauch-Formate an. Denn dabei kann man dann doch etwas ins Grübeln geraten:

Sucht man in dieser Tabelle eine Kombination für typische Breitbild-Produktionen so findet man kaum passende Verhältnisse zwischen 2,35 und 2,40:1. Besitzt die gewünschte Kamera einen 16:9 Sensor, so würde hierfür ein 1,33x Anamorphot passen. Diese Kombination bietet jedoch nur eine sehr subtile anamorphotische Ästhetik. Ansonsten fällt nur noch die Kombination aus 6:5-Sensor und 2x Anamorphot ins Auge. Diese liefert eine extreme Stauchung, bei der die horizontale Auflösung verdoppelt wird.
Nun gibt es jedoch fast keine digitalen Cine-Kameras mit einem nativen 6:5 Sensor, sondern dieses Ausleseverhalten wird in der Regel durch einen Sensor-Crop realisiert. Also durch die Auslesung einer verkleinerten Sensorfläche. Und genau hier gibt es den nächsten Stolperstein zu beachten: Den Bildkreis, den der Anamorphot abdeckt.
Die Quadratur des anamorphen Bildkreises
Gibt ein Hersteller an, dass sein anamorphotisches Objektiv einen S35-Sensor "abdeckt", so könnte man meinen, dass der Bildkreis einen Sensor mit den typischen S-35/APS-C Abmessungen (als mindestens ca. 24 x 18 mm) ausleuchten könnte. Da ja die breitere Seite den Bildkreis limitiert und das Bild durch die Stauchung fast quadratisch (6:5) auf dem Sensor landen kann, könnte man daraus folgern, dass bei einem solchen Objektiv die Höhe der ausgelesenen Sensorfläche ebenfalls mindestens 24mm betragen darf, weil dies ja die minimale Breite ist, die von einem S35-Objektiv abgedeckt werden müsste.
Tatsächlich ist dem jedoch nicht so. Stattdessen geben manche Hersteller mittlerweile (wohl auch, um diese Verwirrung zu vermeiden) den Bildkreis oft mit zwei Zahlen an. (Beispielsweise "Bildkreis: 28,8 x 18mm").
Abstrus ist nicht unbedingt, dass hier kein typisches Quadrat zur Definition des Bildkreises angenommen wird. Jedoch bezeichnen die Hersteller mit diesen Angaben keine reale, sondern eine virtuelle Sensorgröße NACH der Entstauchung in der Postproduktion. Maßgeblich ist daher eigentlich immer nur die zweite Zahl, also die Bild- bzw. Sensorhöhe. Diese Zahl sollte beim Bildkreis logischerweise immer größer sein als die reale Sensorhöhe, damit der Bildkreis die gewünschte Sensorfläche komplett abdecken kann.
Und die Praxis?
Selbst wer bis hierhin noch gedanklich gefolgt ist, dürfte in der Praxis wahrscheinlich nicht am Taschenrechner, sondern beim Cropping per Trial and Error landen. Entweder hat man hier Objektiv und Kamera vor der Produktion exakt auf die gewünschte Aspect Ratio abgestimmt, oder man verschiebt dann das exakte Framing eben in die Postproduktion.
An einem praktischen Beispiel gerechnet: Um mit einem 2x Anamorphoten auf einen Zielauflösung von 4K DCI mit 4.096 x 1.716 Pixeln zu gelangen, müsste der Sensor bei einer 6:5 Auslesung exakt eine Auflösung von 2.048 x 1716 Pixeln bieten - und dabei zugleich den Bildkreis des Anamorphoten effektiv ausfüllen. Oder eben ein ganzzahliges Vielfaches davon, also in den besten Fällen 4096 x 3432, 6144 x 5148 oder 8192 x 6864. Viel Glück bei der Suche.
Pragmatischer ist es daher, die Mathematik hinter dem anamorphen Plan der Realität anzupassen. Wie schon ein Blick auf die obige Tabelle zeigt, kann ein "Perfect Match" aus Anamorphot und Sensor prinzipiell nur sehr selten gelingen. Dies bedeutet, dass man in der Regel immer mehr oder weniger Sensorfläche opfern wird, um auf das gewünschte, korrekte Seitenverhältnis zu kommen. Da man aber in der Regel sowieso mit höherer vertikaler Auflösung als im Zielformat arbeitet, wird daraus vor allem ein ästhetisches Problem: Nämlich ob man letztlich mit den daraus resultierenden, verfügbaren Brennweiten bei der Aufnahme zufrieden ist.