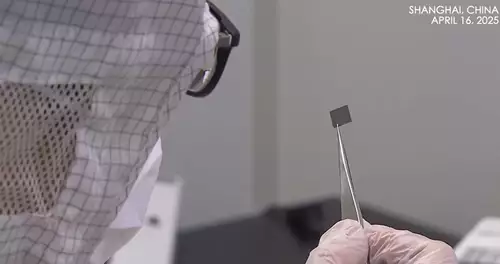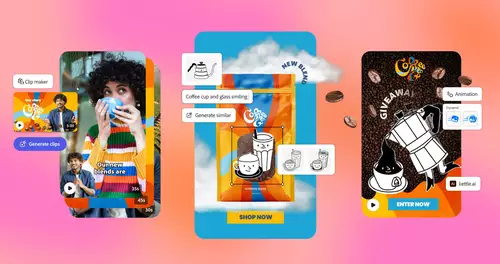slashCAM goes Wildlife: Wir haben die letzten Tage immer wieder mal dazu genutzt, vor die Tore Berlins zu fahren und mit langen Brennweiten auf Tierbeobachtung in freier Wildbahn zu gehen: Kraniche, Bieber und Störche standen auf dem Programm. Zum Einsatz kamen vor allem die Canon EOS C70 mit dem RF 800mm f11.0 IS STM aber auch die Panasonic S5 II mit dem Sigma 150-600MM F/5-6,3 DG DN OS -SPORTS. Hier unsere Erfahrungen - destilliert in 12 allgemeingültige Tipps für Tierfilmer ...
Vorab ein Paar Wildllife-Shots, die wir im Berliner Umland vor allem mit der Canon EOS C70 und dem RF 800mm f11.0 IS STM sowie der Panasonic S5II und dem Sigma 150-600MM F/5-6,3 DG DN OS -SPORTS gesammelt haben:
Welche Brennweite oder wieviel Zeit (und Licht) hast du?
Die Wahl der richtigen Brennweite sollte sich logischer Weise in erster Linie nach dem gewünschten Motiv richten. Kleinere Tiere wie Vögel, Bieber etc. profitieren in stärkerem Maße von längeren Brennweiten als Großwild. (Bei der Wahl der Brennweite raten wir auch das Thema „Fluchtdistanz“ mit einzubeziehen – dem wir ein eigenes Kapitel hier widmen s.u.).
Worüber unserem Eindruck nach eher wenig gesprochen wird, ist die für das Filmen zur Verfügung stehende Zeit (wir sprechen hier vor allem von Wildtieren und nicht Tierparks o.ä.). Wer viel Zeit für die Tierbeobachtung mitbringt, kann in der Regel mehr Aufwand betreiben, um sich den Tieren bestmöglich zu nähern. Wer hingegen ein stärker begrenztes Zeitbudget hat, dürfte froh sein, überhaupt das gesuchte Tier vor die Linse zu bekommen.

Daher gilt für uns: Wer wenig Zeit hat, profitiert in stärkerem Maße von längeren Brennweiten.
Das Thema (Tages) Zeit hat dann wiederum auch Auswirkungen auf die benötigte Lichtstärke und Konvektions-Artefakte (s. eigenes Kapitel weiter unten). Muss man in der Dämmerung unterwegs sein, führt kaum ein Weg an lichtstärkeren aber kostspieligeren Telebrennweiten vorbei.
Andererseits haben wir u.a. mit dem nicht gerade sonderlich lichtstarken Canon RF 800mm f11.0 IS STM gefilmt und waren dann doch ziemlich überrascht, wie unproblematisch die f11 Anfangsblende funktioniert hat – solange man tagsüber damit unterwegs ist.
Gewicht vs Mobilität
Wer in das Outdoor-Filmen einsteigt, neigt häufig dazu, seine Fähigkeit, Gewichte über eine längere Distanz zu tragen, zu überschätzen. Besonders wichtig wird das Kamera-System-Gewicht (zu dem auch weitere Objektive und ein „überdimensioniertes“ Stativ (s. u.) gehören), wenn größere Distanzen zu Fuß auf der Suche nach dem jeweiligen Motiv/Tier zurückgelegt werden müssen.
Erfolgt der Transport dann auch noch in unwegsamem Gelände, kann schnell jedes Kilo extra zur Herausfoderung werden. Hier gilt es sich vorab gut zu überlegen, was tatsächlich mit muss, wieviel das Gesamtequipment wiegt und vor allem auch wie es am besten transportiert werden kann. Wir raten hier auf jeden Fall erstmal zu kürzeren „Probeläufen“, bevor man auf „große Wanderung“ geht.

Bemerkenswert war bei Thema Transport und Gewicht für uns hier die Konstruktion des Canon RF 800mm f11 (UVP. 1.149,- Euro). Mit gerade einmal 1.225g ist es vergleichsweise leicht. Hinzu kommt ein cleverer Einschubmechanismus, mit dem man die 800mm Konstruktion für den Transport auf kompakte 281,8mm zusammenfahren kann.
Zum Vergleich: Das hier ebenfalls genutzte Sigma 150-600 Sport F5-6,3 DG OS HSM (UVP. 2.099,- Euro) wiegt knapp über 2,8kg, ist mit seiner Metallkonstruktion allerdings auch spürbar robuster und solider gefertigt und als deutlich lichtstärkeres (Zoom)Objektiv auch entsprechend aufwendiger entworfen, was sich letztlich auch im Preis niederschlägt (wobei sowohl das Canon als auch das Sigma Objektiv als absolut preiswert gelten dürfen).
Stativkopf mindestens eine besser zwei Gewichtsklassen höher wählen
Wer bislang wenig mit langen Brennweiten zu tun hatte, wird bei der Wahl der Traglast seines Stativkopfes etwas umdenken müssen. Bei kompakteren Kamera-Objektiv-Setups kommt man unserer Erfahrung nach durchaus mit der Faustregel: Traglast Stativkopf = doppeltes Kameragewicht recht gut aus. Liegt das Kameragesamtsystem also etwa bei 5 kg, reicht in der Regel ein Fluidkopf mit einer Traglast von max 10 kg aus.
Dies ändert sich jedoch bei der Verlagerung des Kameraschwerpunktes bei der Nutzung von längeren Telebrennweiten. Hier sollte man sich keinen Illusionen hingeben: Vielleicht bekommt man – je nach Stativsystem – nach der oberen Faustregel noch sein Wildlife-Setup halbwegs tariert. Doch wenn es darum geht, kontrollierte Schwenks und Tilts auszuführen, stößt man hier schnell an Grenzen.
Bedenken sollte man beim Filmen mit langen Brennweiten auch, dass hier häufig minimale Bewegungen am Stativkopf möglichst kontrolliert ausgeführt werden müssen, bsp. um einem Tier zu folgen. Wer hier auf einen zu klein dimensionierten Kopf setzt, riskiert unschöne Nachzieher, Ruckler uvm.
Darüber hinaus bewegen wir uns Outdoor und haben es hier mit zusätzlichen Krafteinwirkungen zu tun – Stichwort: Wind (s.a. nächstes Kapitel). Die Krafteinwirkung von Wind auf ein Kamerasystem können beachtlich sein. Zudem lässt sich meist nur in etwa vorausplanen, wieviel Wind tatsächlich vor Ort herrscht oder ob es vielleicht auch windgeschützte Bereiche gibt.
Unser Panasonic S5II System im „Wildlifesetup“ wiegt beispielsweise mit Sigma 150-600MM F/5-6,3 DG DN OS Sports, V-Mount Akku, Cage, Griffen etc. locker 5 kg. Normalerweise kein Problem für unseren Sachtler FSB 8 (MKI) Stativkopf mit einer Traglast von knapp 10 kg.
Hiermit wurden jedoch kontrollierte Minimal-Bewegungen zur echten Herausforderung. Erst als wir zum nächstgrößeren Sachtler FSB 10 mit 100mm Halbschale und 12kg Traglast gewechselt haben, hatten wir ausreichend Kontrolle.
Ausreichend dimensionierte Stative bedeuten jedoch nicht, dass ein gutes Stabilisierungssystem obsolet geworden ist. Ein gutes Beispiel bieten diese Kranichaufnahmen.

Hier waren wir auf eine Kranichgruppe direkt neben der Landstraße gestoßen. Da die Kraniche meistens fliehen, wenn ihnen Menschen zu nahe kommen, konnten wir nicht aussteigen um, ein Stativ auszubauen. Stattdessen haben wir die Panasonic S5II mit dem Sigma 150-600MM F/5-6,3 DG DN OS Sports mit aktivierter Stabilisierung handgehalten auf dem Türrahmen des Autos aufgestützt gefilmt, was Dank guter Stabilisierungleistung zwischen Objektiv und Kamera vergleichsweise gut funktioniert hat.
Externer Monitor: Komfort vs Wind und Sonne
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die für die Montage eines externen Monitors sprechen – insbesondere auch bei Wildlife Kamera-Setups. Hierzu zählen: Eine Rundum-Sicht außerhalb des Displays, komfortable Bild- und Schärfekontrolle sowie eine ermüdungsfreie Sicht. Letzteres kommt bei der Naturbeobachtung eine nicht unwesentliche Rolle zu. Die Zeiten in denen man nicht auf den Rec-Button drückt, sondern einfach nur auf den „richtigen Moment“ wartet, sind klar in der Überzahl.
Umso wichtiger ist es, eine möglichst ermüdungsfreie Sicht auf das Motiv zu haben – ein externer Monitor hilft hierbei spürbar.

Doch externe Monitore haben auch Nachteile. Bei ungünstigem Sonnenstand können sie – je nach Modell - schwerer abzulesen sein.(Mit dem von uns hier genutzten Atomos Shinobi 7“ hatten wir jedoch keine Probleme bei hellem Umgebungslicht).
Das größte Problem bei Outdoor-Aufnahmen stellt unserer Erfahrung nach jedoch Wind dar. Externe Monitore werden bei Wind quasi zum Segel, wodurch reichlich Vibrationen weitergeleitet werden können.
Es gilt hier also die Vor- und Nachteile von externen Monitoren entsprechend abzuwägen. Ein externer Sucher kann hier durchaus als Kompromiss zwischen Bildkontrolle und geringer Angriffsfläche dienen.
Pre-Rec oder viel Speicherplatz
Wir hatten es bereits erwähnt. Das Warten auf den richtigen Augenblick kann viel Zeit beim Wildlife-Filmen in Anspruch nehmen. Umso ärgerlicher, wenn man den entscheidenden Moment dann verpasst, weil er genau vor dem Drücken des Record-Buttons lag.

Abhilfe schaffen hier zwei Optionen: Entweder investiert man in entsprechend üppigem Speicherplatz, so dass man eher zuviel als zu wenig aufnimmt oder es lässt sich – je nach Kamera – eine Pre-Rec Funktion aktivieren. Mehr Pre-Rec Zeit ist stets besser als weniger. Doch auch ein Re-Rec von 3 Sekunden kann bereits ausreichen, um den entscheidenden Moment einzufangen.
Bei der Kamerawahl für Wildlife-Aufnahmen würden wir wenn möglich stets zu einer Kamera mit Pre-Rec und/oder dualen Cardslots greifen.
Fluchtdistanzen
Wer auf die Bilderpirsch nach einem bestimmten Tier geht, tut gut daran, sich über dessen Verhalten vorab zu informieren. Neben Haupt-Aktivitätszeiten spielt (bei Wildtieren) die Fuchtdistanz eine nicht unerhebliche Rolle.

Unsere Kranich-Aufnahmen bieten hier ein schönes Beispiel: Kraniche sind vergleichsweise große Vögel. Man könnte also versucht sein, bei der maximalen Brennweite zu sparen. Doch weit gefehlt. Kraniche haben eine Fluchtdistanz von 300 Metern. Sie gehören damit zu den eher scheuen Wildtieren.
An der Canon EOS C70 mit ihrem S35 Sensor hatten wir mit dem auf Vollformat gerechneten Canon RF 800mm quasi eine Brennweite von 1.168 mm (1.46 Crop).
Damit sind wir genau ausgekommen. Close-Up Shots waren damit zwar auch nicht möglich (s. Thema Zeit) aber ein 600mm wäre hier schon zu wenig gewesen.
Manueller Fokus vs Animal-AF
Grundsätzlich empfehlen wir (ganz im Gegensatz zur Wildlife Fotografie) bei Bewegtbildaufnahmen mit langen Brennweiten mit manuellen Fokus zu arbeiten. Sehr willkommen sind hierbei ein qualitativ hochwertiges Peaking und eine entsprechende Sucher-Vergrösserungsfunktion.
Autofokussysteme sind hier nach wie vor etwas zu träge, um das schwere Glas von Supertele-Objektiven schnell genug auf schnelle Motive zu fokussieren.
Autofokus-Systeme mit Tiererkennung werden jedoch ständig besser. Hat man erstmal manuell auf ein Motiv scharfgestellt, kann es bei langsamer sich bewegenden Tieren durchaus hilfreich sein, den Animal-AF eine Zeit lang mitlaufen zu lassen. Wir haben hier bei der Panasonic S5II im Verbund mit dem Sigma Sport 100-600 gute Ergebnisse erzielt.
Konvektion oder Hitzeflimmern
Zum Thema lange Brennweiten gehören auf jeden Fall auch Bildstörungen durch thermische Konvektion. Dabei handelt es sich nicht um Bildfehler von Objektiven sondern um ein natürliches Phänomen bei dem durch unterschiedliche warme Luftschichten der Brechungsindex der Luft verändert wird.
Die meisten dürften das Hitzeflimmern über Asphaltstraßen im Sommer kennen. Dieses Phänomen kann verstärkt beim Filmen mit langen Telebrennweiten auftreten - auch im Winter. Je länger die Brennweite und damit potentiell die Entfernung zum Motiv, desto mehr Luft befindet sich auch zwischen dem Kamerastandpunkt und dem Motiv. Gibt es zudem ein starkes Temperaturgefälle zwischen Boden und Umgebungsluft, kann es zu Teils starken Flimmereffekten kommen.

Wichtig: Unserer Erfahrung nach können sich die Temperaturverhältnisse und die damit einhergehenden Flimmerbilder innerhalb von Minuten schlagartig ändern. Manchmal reicht eine vorbeiziehende Wolke, um das Flimmern zu verändern. Es lohnt sich also manchmal einfach etwas abzuwarten oder den Standort zu wechseln, um Flimmerbilder zu reduzieren.
50p - das Wildlife Standardformat
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit aber an dieser Stelle noch einmal erwähnt: Wildlife-Filmen bedeutet langes Warten auf kurze, entscheidende Augenblicke. Umso „kostbarer“ sind dann diese eingefangenen Momente und umso mehr Sinn macht es, diese so gut es geht zu verlängern.

Daher haben sich höhere Frameraten quasi als Standformat für die Tierfilmerei etabliert, da man hier stets die Option behält, auf eine Zeitlupe zu gehen, was auch in unseren Augen viel Sinn macht.
Entsprechend wichtig sind qualitativ hochwertige 50p Aufnahmen. Sowohl die Canon EOS C70 als auch die Panasonic S5II verfügen über entsprechende 10 Bit Log 50p Formate, womit wir auch beim Thema S35 oder Vollformat für Widllife angekommen wären ...
S35 oder Vollformat für Wildlife?
Was wir bei unseren Aufnahmen mit der Canon EOS C70 und der Panasonic S5II tatsächlich schätzen gelernt haben, ist die zusätzliche Ausschnittssvergrösserung Dank S35 Crop an Vollformatobjektiven. Die Canon EOS C70 bringt von Hause aus einen S35 Sensor mit, und die Panasonic S5II cropt automatisch bei 50p auf einen S35 Ausschnitt.
Von daher würden wir bei Wildlife-Anwendungen auch bei einer Vollformat-Kamera stets auf einen hochwertigen S35 Modus achten. Für gelegentliche Establishing-Shots mit Weitwinkel lässt sich bei der S5II dann der Vollformatmodus in 25p wählen und bei der C70 der Canon „Speedbooster“ nutzen.
Doch auch hochauflösende Aufnahmen (6K, 8K) können durchaus Sinn machen, um anschließend zu croppen. Hier gilt es bei der Kamerawahl also abzuwägen, was dem persönlichen Handling eher entgegenkommt: ein nachträglicher Crop von hochauflösendem Material oder ein in hardware gegossener S35 Crop. Ausschlaggebend für unsere Wahl wäre jedoch stets die Wahrung von 50p.
Akkulaufzeit vs der entscheidende Augenblick
Um für den bereits hier mehrfach erwähnten „entscheidenden Moment“ bereit zu sein, empfehlen wir auch bei der Stromversorgung der Kamera entsprechend vorgesorgt zu haben . Für unsere Aufnahmen vor Ort mit der Canon C70 und der Panasonic S5II haben wir mit unterschiedlichen Akku-Setups jeweils 3 Stunden Nonstop-Aufnahme Kapazität sichergestellt.

Bei der Canon EOS C70 reicht ein Standard BP-A30 Akku für rund 200 Minuten Aufnahmezeit und bei der Panasonic S5 II hatten wir einen V-Mount Akku via USB-C für Kamera und Monitor am Start (mehr zu unserem Panasonic S5II Setup dann nach der NAB, wo wir ein ähnliches Energie-Konzept an unserem Interview-Rig im Einsatz haben werden).
Super-Zooms vs interne NDs
Zum Schluß wollen wir noch auf eine weitere Besonderheit im Umgang mit langen Brennweiten hinweisen. Für gewöhnlich reicht unser altgedienter Eclipse Vario ND Filter mit einem Durhmesser von 82mm un entsprechenden Step-Up Ringen aus, um nahezu alle gebräuchlichen Objektivdurchmesser abzudecken.
Bei langen Brennweiten stoßen wir hierbei jedoch an Grenzen. So verfügt das hier genutzte Sigma 150-600mm F5-6,3 DG OS HSM Sports über ein Filtergewinde von 105 mm. Entsprechend gilt es also ND-Filter mit größerem Durchmesser am Start zu haben oder bei der Kamerawahl auf einen internen ND-Filter zu achten.
Soweit unser Ausflug ins Reich der Wildlife- und Tierfilmer. Sollte mehr Interesse hieran bestehen, wird es sicherlich auch noch Follow-Up Artikel auf slashCAM geben. Wir wünschen erstmal eine fröhliche Bilderpirsch.