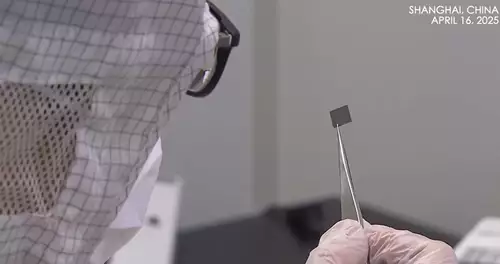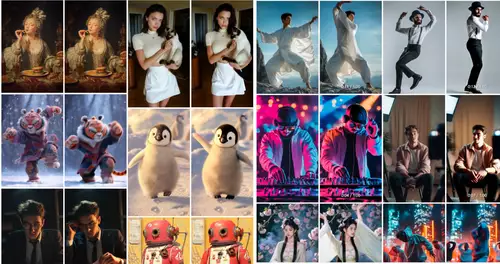Das Thema 16:9 ist immer wieder Gegenstand vieler Diskussionen und Forumsbeiträge. Es herrscht allerdings häufig Unsicherheit bei den technischen Details. Die Grundlagen zum Thema 16:9 soll dieser Artikel liefern.
Unser Standard - Fernsehformat hat ein exaktes Verhältnis von Bildbreite zu Bildhöhe, nämlich 4:3. Dieses Verhältnis hat sich auch in anderen Bereichen durchgesetzt, in denen Bildschirme verwendet werden. Zum Beispiel bei Computern, 640x480 ist genauso wie 800x600, 1024x768 und 1280x960 ein 4:3-Format.
Die Überlegung, ein Bild nicht mit gleicher Höhe und Breite zu produzieren, ist schon viel älter als das Fernsehen; schon bei der Fotografie und beim Film nahm man Rücksicht auf die Anordnung unserer Augen. Leider hat man sich hier nicht durchgängig auf Standards einigen können, die Formatvielfalt ist fast unüberschaubar und geht von 13:9 beim Foto bis 21.15:9 bei Cinemascope. Im Fernsehen dagegen hat sich glücklicherweise neben 4:3 nur ein weiteres Verhältnis durchsetzen können, nämlich 16:9.
16:9 und 16:9
Geht man bei einem 4:3 - Bild davon aus, das die Auflösung in horizontaler und vertikaler Richtung gleich sein soll, so ergibt sich für ein Vollbild mit 576 Zeilen: 576 * 4 / 3 = 768 Spalten.
Dieses Pixelverhältnis von 768 x 576 sollte also eigentlich der Standard bei jedem Videogerät sein.
Bei digitalem Video hat man sich jedoch dafür entschieden, in horizontaler Richtung mit etwas geringerer Auflösung zu arbeiten und kommt hier zu dem weit verbreiteten Pixelverhältnis von 720 x 576.
Soll ein Bild nun im Verhältnis 16:9 dargestellt werden, so bestehen grundsätzlich erstmal zwei Möglichkeiten:
1. Das Bild wird seitlich um die fehlenden Pixel ergänzt, die vertikale Pixelanzahl bleibt also gleich. In unserem Rechenbeispiel ergibt sich: 576 * 16 / 9 = 1024 . Bleibt man bei der etwas geringeren Auflösung von DV - Formaten, ergibt sich 1024 / 1.066~7 = 960.
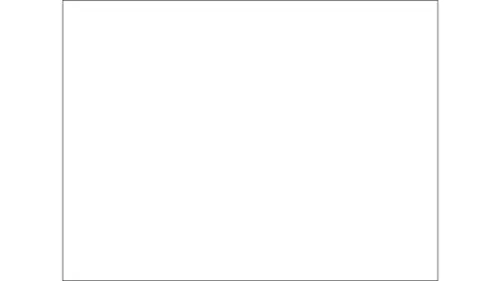
2. Das Bild wird oben und unten um die überschüssigen Pixel gekürzt, die horizontale Pixelanzahl bleibt also gleich. Bei der Rechnung ergibt sich: 768 / 16 * 9 = 432. Passt man auch hier die horizontale Auflösung an das DV-Format an, ergibt sich 720 x 432.
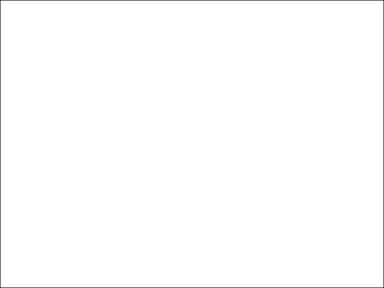
Wir halten also fest:
Bei gleichbleibender Horizontal- und Vertikalauflösung ergeben sich für ein 16:9 Bild zwei mögliche Pixelverhältnisse, 1024 x 576 oder 768 x 432.
Gleicht man diese Pixelverhältnisse an die etwas geringere horizontale DigitalVideo - Auflösung an (Korrekturfaktor 1.066~7), ergeben sich die beiden Pixelverhältnisse 960 x 576 und 720 x 432.
16:9 auf 4:3
Nach wie vor sind jedoch die meisten Fernseher im 4:3 - Format. Genauso sind fast alle Videorekorder, Fernsehsender und Übertragungswege nicht in der Lage, horizontal mehr als 720 Spalten aufzuzeichnen oder zu übertragen. Deshalb hat sich in vielen Bereichen das Format 720 x 432 durchsetzen können. Es wird also in ein normales 4:3 - Bild oben und unten ein schwarzer Balken eingeblendet. Das ganze erinnert ein wenig an einen Briefkastenschlitz, was den Begriff Letterbox prägte. Der größte Nachteil dieses Verfahrens ist die Tatsache, dass das Bild kleiner wird. Ansonsten ist daran eigentlich nicht auszusetzen. Das Bild wird eigentlich nicht schlechter, die Auflösung hat sich ja nicht geändert. Es stehen zwar weniger Zeilen zur Verfügung, aber das Bild ist ja auch kleiner. Viele DV-Kameras bieten einen 16:9 - Modus, in dem nur 720 x 432 Pixel aufgezeichnet werden. Das Bild wird mit Balken im Sucher eingeblendet, damit man bei der Aufnahme schon den Bildausschnitt beurteilen kann. Ein wenig Filmlook in den Aufnahmen kann man damit schon sehr schön erzeugen.
16:9 auf 16:9
Wer viel Kinofilme sieht, der hat sich wahrscheinlich irgendwann einen 16:9 - Fernseher angeschafft. Diese Fernseher bieten meistens verschiedene Möglichkeiten, das Bild anzupassen. Der geometrisch richtige Modus für normales Fernsehprogramm in 4:3 ist natürlich auch 4:3, d.h. rechts und links des Bildes werden schwarze Balken eingeblendet. Sieht man in dieser Einstellung einen 16:9 - Film, hat man nun rechts, links, oben und unten einen schwarzen Balken. Hierfür gibt es dann die Funktion 16:9 - Zoom, das Bild wird also soweit vergrößert, dass keine Balken mehr zu sehen sind. Doch Achtung, das Bild wird unschärfer. Hier rächt sich jetzt die Tatsache, dass in 720 x 432 Letterbox produziert wurde anstatt in korrekteren 960 x 576.
Der anamorphe Kompromiss
Bilder mit dieser höheren Auflösung lassen sich jedoch nicht mit einer Übertragungs- oder Produktionkette verarbeiten, die nur für 720 x 576 ausgelegt ist. Aus diesem Grund suchte man nach einem Kompromiss, der einerseits den klassischen Produktionswegen gerecht wird und andererseits zumindest einen Teil der möglichen Qualtität bietet. Man fand ihn in der sogenannten anamorphen Aufzeichnung. Dabei staucht ein spezielles Objektiv (ein sogenannter Anamorphot) den Bildausschnitt horizontal zusammen, so dass aus einem geometrisch korrekten 960 x 576 - Bild

ein geometrisch unkorrektes 720 x 576 - Bild
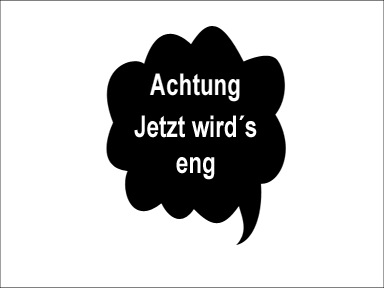
entsteht. Bei diesem Prozess geht zwangsläufig die horizontale Auflösung verloren, die vertikale dagegen bleibt erhalten. Das gestauchte Bild sieht ein wenig seltsam aus, Personen z.B. haben Eierköpfe und Fussbälle sind nicht mehr rund. Um diesen "Fehler" zu korrigieren, muss bei der Wiedergabe auf dem Fernseher das Bild wieder entzerrt werden. Diese Entzerrung bezeichnet man auch als 16:9 - Formatumschaltung.
Der Trick der anamorphen Aufnahme ist übrigens nicht neu. Schon beim Cinemascope hat man bei der Aufnahme das Bild optisch verzerrt, um möglichst viel Auflösung auf einen 35mm Film zu bekommen. Bei der Wiedergabe im Kino hat man das durch einen entgegengesetzt wirkenden Anamorphot wieder ausgeglichen.
Anamorphe Vor- und Nachteile
Bei einem 16:9 - Fernseher kann jetzt auch ein 16:9 - Bild ohne schwarze Balken und mit voller vertikaler Auflösung dargestellt werden. Es ist also zumindest in einer Richtung schärfer und die Anschaffung eines teuren Fernsehers hat sich gelohnt.
Um das zu erreichen, müssen allerdings eine ganze Menge technische Klimmzüge gemacht werden:
1. Grundsätzlich muss erst einmal sichergestellt werden, dass das Bild auf jedem 4:3 - Fernseher korrekt aussieht. Da nicht jeder Fernseher eine 16:9 - Formatumschaltung besitzt, muss die letzte vom Produzenten kontrollierbare Einheit das Bild stauchen. Beim ausgestrahlten Fernsehen ist das bedauerlicherweise der Sender selbst. In diesem Fall steht also nur während des Produktionsprozesses die höhere Auflösung zur Verfügung.
Bei DVD - Playern und digitalen SetTop-Boxen kann man dagegen einstellen, in welchem Format das Bild ausgegeben werden soll. Hier erreicht also das anamorphe Signal auch den Zuschauer.
Diese Probleme bei der Ausstrahlung führten übrigens dazu, dass 16:9 ein fester Bestandteil von PALPlus und HDTV (HighDefinitionTeleVision) wurde. Bei PALPlus z.B. wird das Bild im Sender von 576 auf 432 Zeilen durch Weglassen von Zeilen gestaucht. Die herausgerechneten Zeilen werden dann als sogenannte Helper - Signale codiert und nahezu unsichtbar in den schwarzen Balken oben und unten übertragen. D.h. es steht sowohl ein geometrisch korrektes 4:3 Letterbox Bild als auch ein, im PALPlus-Dekoder erzeugtes, anamorphes 16:9 - Bild zur Verfügung.
2. Während des Produktionsprozesses müssen alle Geräte in der Lage sein, ein anamorphes Signal bearbeiten zu können.
Videorekorder sind dabei unproblematisch, sie zeichnen einfach 720 x 576 auf. Hartschnitte sind also auch mit jedem "nichtkompatiblen" Gerät möglich.
Die Fernseher müssen eine 16:9 - Formatumschaltung besitzen, damit sie das Bild korrekt anzeigen. Das kann heutzutage eigentlich jeder Profimonitor. Möchte man zu Hause anamorph produzieren, sollte man darauf achten, dass der Schnittmonitor oder Fernseher das ebenfalls kann.
Schwierig wird es bei allen Neuberechnungen. Dazu zählen Effekte (besonders geometrisch anfällige wie z.B. Kreisblenden) genauso wie Schriften und Grafiken. Entweder muss das Schnittprogramm in der Lage sein, die Effekte auch gestaucht zu berechnen oder der Codec der Schittkarte muss eine 16:9 - Unterstützung bieten. Dabei wird beim Decodieren jedes Einzelbild auf 960 x 576 gestreckt oder auf 720 x 432 gestaucht. Das Schnittprogramm kann dann einen geometrisch korrekten Effekt berechnen und bei der Codierung skaliert der Codec das Bild wieder auf 720 x 576 zurück. So sollte man übrigens auch das Anfertigen von Grafiken in externen Programmen handhaben. Man produziert mit 960 x 576 Pixeln (natürlich nicht mit 720 x 432) und speichert sie dann mit 720 x 576 ab, bevor man sie ins Schnittprogramm importiert.
Noch ein Wort zu Kameras und Schnittkarten
Es gibt eine Reihe von DV-Kameras, die im 16:9 - Modus in der Lage sind, auch ein anamorphes Signal aufzuzeichnen. Man sollte jedoch genau hinschauen, wie es erzeugt wird. Normalerweise sollten Camcorder eine (oder 3) CCD - Flächen von etwa 720 x 576 Pixeln besitzen (also um die 415.ooo Pixel). Um damit ein 16:9 - Bild zu erzeugen, nehmen fast alle Camcorder jedoch nur 720 x 432 Pixel vom CCD auf und strecken sie elektronisch, um die Verzerrung zu erreichen. Dabei erhält man k e i n e n Schärfegewinn. Entweder man benutzt also eine anamorphote Vorsatzline (ab etwa 800.- EU zu haben[1]) oder der Camcorder hat einen 16:9 - CCD, also eine Auflösung von 960 x 576 Pixel direkt auf dem CCD. Dann kann das Bild auf 720 x 576 gestaucht werden, verliert dabei nicht an vertikaler Auflösung und ist trotzdem anamorph. Der einzige DV - Camcorder, der meines Wissens dazu in der Lage ist, ist von JVC-Professional und heisst GY-DV700. Seinen eigenen Camcorder kann man übrigens ganz einfach überprüfen: Im 16:9 - Modus muss der Bildausschnitt rechts und links weitwinkliger als bei 4:3 sein. Ist er das nicht, so wird das Bild nur elektronisch skaliert.
Auch bei Videoschnittkarten schadet ein Blick auf die 16:9 - Unterstützung nicht. Diese kann sich auf 2 Dinge beziehen:
1. Das Schnittprogramm bietet für seine Effekte keine 16:9 - Unterstützung und überlässt es dem Codec, für eine korrekte Geometrie zu sorgen (siehe oben). Premiere Cutter sind in den meisten Fällen schon fein raus, denn es besitzt für seine internen Effekte schon eine 16:9 - Unterstützung (zu erreichen über Projekteinstellungen - Videofilter - Pixel/Seitenverhältnis).
2. Der Fernseher hat keine manuelle sondern nur eine automatische 16:9 - Formatumschaltung. Er überlässt es dem Videorekorder (der das hoffentlich kann), am Scart-Ausgang (PIN8) ein Schaltsignal zu generieren, welches dann den Fernseher zum Umschalten veranlasst. Dazu ist ein Statusbit notwendig, dass (wenn es der Videorekorder bei der Aufnahme nicht selbst setzen kann) von der Videokarte gesetzt werden muss.
Ob eine 16:9 - Unterstützung durch die Videokarte notwendig ist, kann man also anhand seines eigenen Equipments schnell überprüfen.
The End
Für eine korrekte anamorphe 16:9 - Produktion benötigt man Folgendes:
1. Einen Camcorder mit 16:9 - CCDs oder optischem Anamorphot.
2. Ein Schnittprogramm mit 16:9 - Unterstützung, wenn Effekte oder Titel verwendet werden (Alternativ funktioniert auch ein DV - Codec, der die Skalierung übernimmt)
3. Einen Fernseher, der 16:9 ist oder eine 16:9-Formatumschaltung besitzt.
Sollte weder ein Camcorder mit 16:9 - CCDs noch ein optischer Anamorphot bei der Aufzeichnung zur Verfügung stehen, so besteht theoretisch immerhin noch die Möglichkeit, Titel und Effekte in voller vertikaler Auflösung zu produzieren. Ob sich nur dafür allerdings der Aufwand lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Wahrscheinlich ist hier ein von Anfang an mit schwarzen Balken (also 720 x 432) produziertes Bild die einfachere Variante.
Ich hoffe, ein wenig Licht in das Wirrwar von optischer und elektronischer Verzerrung, Auflösung und sonstigem Fremdworten gebracht zu haben. Dieser Artikel soll nicht entmutigen, sondern dazu ermuntern, mit Verstand und vertretbarem Aufwand zu seinem eigenen 16:9 - Video zu kommen.
HS
[1] http://www.centuryoptics.com/products/video/digital/dig16-9.html
http://www.optexint.com/digivid/anamorph.htm
http://www.zgc.com/html/anamorphic_attachment.html