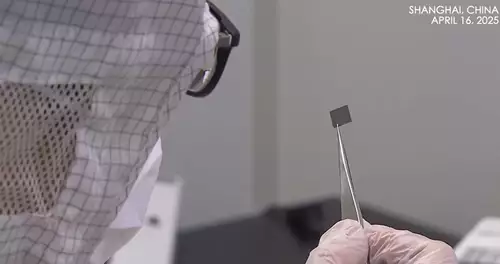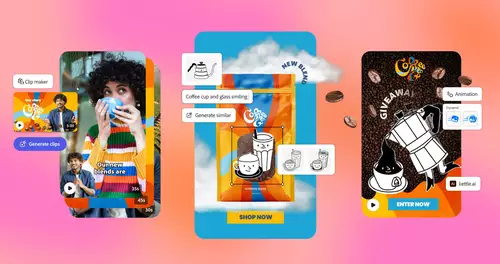Derzeit gelangen erste Camcordermodelle in den Handel, mit denen sich stereoskopische 3D-Aufnahmen einfach machen lassen. Ob es diesmal tatsächlich gelingen wird, 3D als ein Format für die Massen zu etablieren? Unter anderem darüber haben wir mit Josef Kluger gesprochen. Er produziert seit über zehn Jahren in 3D (zuletzt für die BBC und Sony) und wirkt maßgeblich bei mehreren großen Forschungsprojekten mit. In unserem Gespräch ging es außerdem um verschiedene Konvergenz-Philosphien (vorher oder nachher?), ungünstige Brückentechnologien (aus 2D mach 3D), kollidierende Tiefeneindrücke (ist es vorne? ist es hinten?), Adaptionsprozesse im Gehirn (mehr! mehr!), und nicht zuletzt auch um die Scheu der Filmemacher, Neuland zu betreten...
 Seit über zehn Jahren produziert Josef Kluger mit seiner KUK Filmproduktion GmbH in München unter anderem stereoskopische Filme, dabei wurde ein kompletter Aufnahme- und Postproduktions-Workflow für alle wesentlichen Bereiche der stereoskopischen Filmaufnahme selbst entwickelt. Die Firma zählt mittlerweile zu den renommiertesten 3D Pionieren Europas, und ist Partner in den EU Forschungsprojekten 3D4YOU und MUSCADE, sowie im deutschen Forschungsprojekt PRIME (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie), bei dem in Zusammenarbeit mit dem Heinrich Hertz Institut Berlin und dem Fraunhofer Institut Erlangen neue 3D Produktionstechniken entwickelt werden.
Seit über zehn Jahren produziert Josef Kluger mit seiner KUK Filmproduktion GmbH in München unter anderem stereoskopische Filme, dabei wurde ein kompletter Aufnahme- und Postproduktions-Workflow für alle wesentlichen Bereiche der stereoskopischen Filmaufnahme selbst entwickelt. Die Firma zählt mittlerweile zu den renommiertesten 3D Pionieren Europas, und ist Partner in den EU Forschungsprojekten 3D4YOU und MUSCADE, sowie im deutschen Forschungsprojekt PRIME (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie), bei dem in Zusammenarbeit mit dem Heinrich Hertz Institut Berlin und dem Fraunhofer Institut Erlangen neue 3D Produktionstechniken entwickelt werden.
Schon 2004 wurde ein 12 min. Imagefilm für Robert Bosch GmbH über Innovationen in der Automobiltechnik in 3D realisiert. Es folgten ua. ein Film über das 24h-Rennen am Nürburgring (15min / 2007 / mehr Info) sowie der zusammen mit der BBC produzierte, erste Pilotfilm im Bereich 3D Naturfilm, PEREGRINE (dieser wurde auf der NAB 2010 gezeigt / mehr Info). Im Auftrag von Sony und des DFB dokumentierte Kluger und sein Team das Training der Nationalmannschaft in Südtirol in 3D, und -- ganz aktuell -- auch die Proben von Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern. Letzteres hatte unlängst auf der IFA Premiere.
Herr Kluger, Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren mit 3D -- wieso diese Spezialisierung?
Die KUK-Filmproduktion gibt es seit 1992. Wir haben uns von einer Produktion von Image-, Corporate- und Industriefilmen zu einer Firma entwickelt, die Spezialformate produziert für Themenparks, Weltausstellungen und Großevents. Spezialformate sind zum Beispiel 360-Grad Projektionen, Motion Ride Filme mit bewegten Plattformen, alle möglichen Multiscreen-Formate. Und in diesem Bereich war es für uns klar, daß wir uns für ein Komplettangebot auch um 3D kümmern müssen. Themenparks haben immer wieder diese sogenannten 4D-Theater ausgestattet, wo zu den 3D-Effekten auch verschiedene Bewegungseffekte hinzukommen, haptische Effekte, physikalische Effekte wie Wasserspritzen, wie...
... Smell-o-vision...
Genau -- das war schon immer ein Medium für den Themenpark, das die Immersivität gestärkt hat. Also war es einfach wichtig, das gesamte Spektrum anbieten zu können. Und es war für mich auch als Möglichkeit, das Publikum mehr einbeziehen zu können als beim normalen 2D-Film, sehr spannend. Denn das ist ja was man immer versucht, mit den großen Attraktionen, daß man soviel Immersivität schafft wie möglich und das Publikum wirklich eintauchen läßt. Deshalb haben wir 2000 mit den ersten Tests begonnen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir alle Aufnahme- und Postproduktionstechniken selbst entwickelt, denn es gab ja kein 3D-Rig zu leihen, außer in den USA vielleicht ein-zwei, und genauso war es auch im Bereich Postproduktion. Die Geräte, die Hardware und Software, die heute zur Verfügung steht, um diese zwei Streams für das linke und rechte Auge parallel, gleichzeitig in Realtime zu bearbeiten, davon war man 2000 noch weit entfernt. Also haben wir selbst Möglichkeiten geschaffen, auf einem HD-Stream mit entsprechenden Spiegelvorsätzen ein Bild in 3D schneiden zu können. Da haben wir wirklich Pionierarbeit geleistet -- uns erstmal für Eigenproduktionen mit dem Thema beschäftigt und uns fit gemacht, sodaß wir dann auch relativ früh für erste Themenparks und Kunden wie beispielsweise Bosch 3D-Produktionen realisieren konnten. Anfangs haben wir noch auf 35mm gedreht, bzw. Super 35mm, und dann haben wir natürlich sehr schnell die High Definition Digitaltechnik verwendet um zu produzieren.

Auch wieder mit eigenen Formaten?
Immer mit eigenen Rigs, bis heute. Was wir in der Postproduktion heute aber eingekauft haben, ist ein Piranha-System, bei dem man in der Lage ist, mit Dual-Stream zu arbeiten, also 2x Full HD unkomprimiert in das System zu streamen, dort zu bearbeiten, geometrisch und farblich die Ströme anzupassen, und die Bearbeitungsschritte über zwei Beamer in Realtime auf der Silberleinwand projizieren zu können.
Digitaltechnik machts möglich – und komfortabel
Es heißt ja generell, Dank der Digitaltechnik könnte diesmal der Durchbruch für 3D gelingen, weil es sovieles einfacher macht.
Die Digitaltechnik macht es einfacher, aber sie macht es auch präziser, und sie macht es auch vom Betrachtungserlebnis her angenehmer. Ich denke, was in den 50er-60er Jahen den 3D-Boom zum Versiegen gebracht hat, waren letztlich Mängel in der Technik. Mit zwei 35mm-Projektoren hat man Probleme im Bildstand, und auch die Kontrolle am Drehort war nicht in der Weise möglich wie heute, etwa mit 3D-Displays und Assistenzsystemen wie Stan, der Stereoscopic Analyzer, den wir gemeinsam mit dem Fraunhofer Heinrich-Hertz Institut entwickelt haben, um am Drehort die Kameras perfekt zu kalibrieren und einzustellen. Denn man braucht für einen guten 3D-Eindruck auf der technischen Seite zwei Bilder, die sich möglichst wenig von ihren Farb- und Helligkeitswerten und von ihren Geometrien unterschieden. Genau das ist heute mit der Digitaltechnik möglich, und deshalb haben wir jetzt unter dem Aspekt der angenehmen 3D-Betrachtung wirklich einen guten Stand erreicht, sodaß der Zuschauer nicht abgeschreckt wird oder Kopfschmerzen bekommt. Jetzt kann man sich darum kümmern, neben der reinen technischen Beherrschung dieses Themas auch die dramaturgischen Möglichkeiten, die 3D bietet, weiterzuentwickeln, und wirklich als Stilmittel einzusetzen für Storytelling, für die emotionale Einbindung des Publikums in eine Szene.
Aber es gibt ja viele Faktoren, die man meistern muß, wenn man gutes 3D aufnehmen möchte. Man muß die Brennweite festlegen, genau wissen wie die Objekte im Raum gestaffelt sind, wie weit der Abstand ist, der abgedeckt werden muß -- da ist es doch wichtig, daß man alles richtig macht, oder?
Ja, das ist der Unterschied zu einer 2D-Produktion. Wenn Sie die falsch belichten, tut es nicht unbedingt weh -- es ist zwar nicht schön anzusehen, aber das 2D-Bild wirkt nicht so direkt auf unser Sehsystem und die Augenmuskeln, die überanstrengt werden beim schlechten 3D-Bild. Man kann das aber schon ein bißchen mit Belichtung vergleichen. Man hat da auch einen gewissen Spielraum, in dem man durch Belichtung ein Bild gestalten kann. Es gibt den korrekt-technisch errechneten Blendenwert, aber jeder Kameramann wird von dem etwas abweichen, je nachdem welche kreative Idee dahintersteckt. Ähnlich ist es beim 3D-Bild. Man kann das technisch perfekt einstellen und dann wird man es je nach der gewünschten Tiefenwirkung vielleicht in der einen oder anderen Weise von den Einstellungen her verändern.
Es gibt ja zwei Faktoren, die entscheidend sind bei der Aufnahme, einmal die Stereobasis, also der Abstand zwischen den Kameras, und die Konvergenz. Die Stereobasis beeinfusst dabei die Stärke des 3D-Effekts, also wie weit sich die Objekte im Raum staffeln, richtig?
Ja, aber insgesamt muß man das Zusammenspiel aus den Faktoren Stereobasis, Brennweite, Abstand des nächsten Objekts zum Betrachter, Abstand des entferntesten Objekts zum Betrachter, Leinwandgröße und Betrachtungsabstand im Kino berücksichtigen. Das alles ist in Algorithmen zusammengefaßt. Es ist die Aufgabe des Stereographers die Werte so zu berechnen, daß sie dann in der geplanten Wiedergabesituation funktionieren, aber auch Toleranzen einzubauen, sodaß ein Film der für eine große Leinwand konzipiert wurde, auch auf einem Display noch funktioniert, oder umgekehrt.

Kann man denn so produzieren, daß es auf beiden Größen gezeigt werden kann?
Man kann sicherlich so drehen, man orientiert sich dann an der größeren Leinwand und nimmt in Kauf, daß auf der kleineren Leinwand beziehungsweise am Display der 3D-Eindruck etwas schwächer ist. Wenn man es umgekehrt macht, würde man auf der großen Leinwand das 3D überziehen und hätte dann ein Problem mit der Wahrnehmung. Umgekehrt ist es eher tolerierbar. Ich glaube, auch große Filme wie die Blockbuster werden für Bluray und DVD nicht nochmal produziert. Wobei wir jetzt gerade im Rahmen von Forschungsprojekten auf europäischer Ebene (3D4YOU und MUSCADE) Formate entwickeln, die es ermöglichen, hinterher am Display genau diesen Tiefeneindruck am Fernsehgerät selbst einzustellen, genau wie jetzt Kontrast und Helligkeit. Auch im deutschen Forschungsprojekt Prime, gefördert vom Bundeswirtschaftministerium, arbeitet das Fraunhofer Institut gemeinsam mit Loewe an Justiermöglichkeiten für die Tiefe bei der Betrachtung im Wohnzimmer, damit man genau diese Diskrepanz zwischen den Parametern für die große Leinwand und dem kleineren Display ausgleichen kann.
Es gibt ja jetzt auch schon diese Fernseher, die automatisch einen 2D-Film in 3D ausgeben, aber das funktioniert noch nicht sehr gut...
Wird auch nicht wirklich funktionieren, das ist eine reine, fragwürdige Brückentechnologie, entstanden aus dem Zwang der Displayhersteller, die Geräte verkaufen wollen, für die es noch nicht genug Content gibt -- keiner ist damit glücklich. Ich sehe eine große Gefahr darin, weil der Konsument eher abgeschreckt wird von der mangelhaften Qualität. Sie kann auch nur mangelhaft sein, denn die Algorithmen, mit denen da gerechnet wird, sind sehr simpel. Das ist vergleichbar mit wenn sie ein Schwarz-weiß-Bild automatisch in Farbe umrechnen wollen. Da können sie auch nur sagen: oben ist meistens der Himmel, also mach ich oben blau rein, unten ist vielleicht eine Wiese, da setz ich dann grün ein.
Das einzige was zuverlässig Inhalte für die neuen Displays liefert wären dann Computerspiele.
Ja, mit den Computerspielen hat man ein sehr breites Content-Angebot, und man hat da auch Technologien, die ein gutes 3D generieren. Wobei man prinzipiell die Problematik hat, daß viele Texturen rein flächig in 2D gestaltet sind. Wenn bei einem Rennspiel das Publikum am Rand der Strecke steht als flache 2D-Textur, entlarvt sich das sofort in einer dreidimensionalen Darstellung. Also müssen auch die Game-Entwickler nachrüsten, und Objekte im Spiel auch räumlich gestalten. Generell aber hat man dort ein großes Reservoir an 3D-Content, auch wenn auf allen Ebenen hektisch daran gearbeitet wird, um mehr Content zu produzieren.
Ich denke, 3D-Live wird ein großes Thema, da kann man relativ schnell an Content kommen, etwa Sportübertragungen, oder was wir gerade vorbereiten: die Fantastischen Vier geben am 28. September ein Sonderkonzert in Halle, das in 3D live in annähernd hundert Kinos übertragen wird. Das wird eine Weltpremiere, aber es gibt noch weitere Konzepte in Richung alternativer Content für die Kinos. Da ist 3D eine treibende Kraft, weil das Kino einen ganz neues Business-Case bekommt.

Konvergenz-Philosophien, Depth Grading und Schärfe-Interpolation
Lassen Sie uns nochmal auf die 3D-Aufnahmesituation zurückzukommen... Stichwort Konvergenz: Diese kann man einmal beim Drehen schon einstellen, aber auch später beim Depth Grading verändern. Wie ist denn das -- wenn ich eine Konvergenz beim Dreh einstelle, habe ich nachher einen genauso großen Spielraum, oder sollte man eher mit einer Konvergenz von Null drehen?
Das sind generell die zwei großen Philosophien in der Welt der 3D-Aufnahme -- im US-Bereich wird eher konvergiert, hier in Europa ist man eigentlich eher übereingekommen, parallel zu drehen, also mit null Konvergenz. Das war von Anfang an auch immer unser Ansatz, sozusagen der geometrisch korrekte Ansatz, mit zwei großen Vorteilen. Wenn man nicht konvergiert, zeigen die Bilder keine Parallaxverschiebungen, denn sobald man konvergiert, sind die Bilder gewinkelt, und es zeigen sich Parallaxen im Bild, die man dann wieder komplex ausgleichen muß in der Nachbearbeitung. Und zweitens hat man den größeren Spielraum, das gesamte Tiefenbudget hinterher in der Post anpassen zu können, auch dynamisch anzupassen, wenn sich in einer Einstellung so viele Dinge verändern, daß es erforderlich ist, die gesamte Tiefe zu korrigieren.
Also, daß man das gesamte Stereofenster nach vorne oder nach hinten schiebt?
Genau, das wird oft bei uns dynamisch animiert, und wenn das alles schon fixiert ist durch konvergiertes Drehen, nimmt man sich diese Möglichkeit zum großen Teil.
Geht es dann gar nicht, oder nur eingeschränkt?
Nur noch eingeschränkt. Man hat immer damit zu kämpfen, daß eine horizontale Linie in den Kameras verwinkelt erscheint. Man schaut einmal von rechts und einmal von links jeweils verwinkelt darauf, während es beim parallelen Drehen geoemtrisch korrekt abgebildet wird, und dadurch alles leichter zu verschieben ist.
Gegen das parallele Drehen wird als Argument angeführt, daß man natürlich für die Verschiebung der beiden Bilder skalieren muß, das heißt, ich muß etwas reinzoomen in die Bilder. Dadurch gibt es einen leichten Auflösungsverlust. Diesen Verlust habe ich aber eigentlich auch beim konvergierten Drehen, denn ich muß ja auch das Bild manipulieren, also die Pixel verschieben im Hinblick auf den Parallaxenausgleich. Also habe ich hier einen ähnlichen Eingriff in die Bilder, zwar nicht Skalieren, aber Warpen. Wenn man jetzt auch an höher aufgelöste Aufnahmeformate denkt, 2K, 4K, dann ist dieser Nachteil zu vernachlässigen und die Vorteile beim parallelen Drehen überwiegen auf jeden Fall.
Wie arbeitet man denn überhaupt beim Depth Grading, um nachträglich die Konvergenz einzustellen?
Mit cropping and scaling, man skaliert und verschiebt die Bilder zueinander. Man definiert immer durch die Lage der zwei Bilder zueinander, wo die Bildebene ist. Auf der Leinwandebene sind Referenzpunkte in den beiden Bildern auf einer Position -- der Konvergenzpunkt. Am Beispiel Text: wenn ich einen Titel mache und ihn genau auf der Leinwandebene positioniere, ist ein Buchstabe in beiden Bildern deckungsgleich. Wenn ich die zwei Bilder zueinander verschiebe, gibt es einerseits die positive Parallaxe, dann schiebt sich das nach hinten, oder eine negative Parallaxe, dann kommt es nach vorne raus.
Verschiebt man dabei nur gewisse Teile oder das gesamte Bild?
Den gesamten Bereich, aber durch Maskierung kann ich auch die einzelnen Ebenen voneinander trennen und verschieben. Wir hatten das zum Beispiel bei einer Einstellung, in der ein Rennfahrer im Auto sitzt mit Blick auf die Rennstrecke, da haben wir auch explizit die Rennstrecke separiert vom Innenraum gedreht, um die beiden Tiefenbereiche zu einander justieren zu können. So kann in jeder Situation die Tiefe optimal gestaltet werden.

Apropos Auflösungsverlust. Man ist bei 2D-Bildern ja einigermaßen empfindlich für die Auflösungsgröße, aber bei 3D scheint es so zu sein, daß man gar nicht richtig beurteilen kann, wie hoch sie ist -- diese einfachen 3D-Kameras arbeiten ja mit einer ziemlich geringen Auflösung etwa im Side-by-side-Verfahren, aber es soll nicht so eklatant auffällig sein beim Anschauen, wegen der räumlichen Staffelung.
Mit der Auflösung hatten wir eigentlich nie Probleme. Es gibt den Effekt, daß man die Bilder subjektiv schärfer sieht in 3D, weil die beiden Augen ein gewisses Grundrauschen in den Bildern, das in jedem Bild leicht anders ist, interpolieren, und dadurch ein subjektiv schärferes Bild generieren. Es findet also eine Art Interpolation im Gehirn statt: aus zwei verrauschten Objekten entsteht sozusagen ein Neues, Unverrauschteres.
Im Umkehrschluss, wenn man 3D wirklich in FullHD projiziert, bekommt man also nochmal ein scheinbar deutlich höher aufgelöstes Bild?
Ja, zwar wird aus zwei mal 2K immer noch nicht 4K, denn es ist ja derselbe Bildinhalt, aber der Seheindruck wird nochmal etwas schärfer.
3D für Consumer, geht das?
Diese Consumer-Camcorder, die jetzt eingeführt werden, sind zum Teil ja relativ einfach, sie zeichnen die zwei Bilder direkt in einem Bildstrom auf, und es läßt sich auch nicht sehr viel einstellen an ihnen, weder Stereobasis noch Konvergenz. Wie schätzen sie diese Kameras ein? Man muß es für den Massenmarkt wahrscheinlich einfach machen, aber kann man damit noch sinnvoll arbeiten?
Wenn man sich mit diesen Kameras genau an die Limits hält, die durch die stereoskopische Optik, durch die Kamerabasis vorgegeben sind, also genau in dem Bereich fotografiert, kann das ein durchaus akzeptables Bild sein. Die Gefahr besteht aber darin, daß natürlich unerfahrene Fotografen damit fotografieren wie in 2D, etwa Nahaufnahmen machen ohne zu berücksichtigen, daß wir den Blick haben bis zu den Alpen im Hintergrund, und schon verletzt man alle stereoskopischen Regeln, und das Bild ist nicht mehr zu betrachten. Nichts ist schneller versaut, als ein stereoskopisches Bild... Die Einfachheit dieser Systeme bedingt also auch, daß die möglichen Aufnahmesituationen sehr limitiert sind.
Man müsste die Kameras im Grunde mit einem Warnhinweis versehen, daß nur in einem gewissen Bereich damit gearbeitet werden kann.
Ja, das wird sicher kommen. Und so wie sich der Autofokus ja auch entwickelt hat oder die automatische Belichtung, wird die Industrie sicher daran arbeiten, die stereoskopische Einstellung immer weiter zu automatisieren. Es steckt mittlerweile sehr viel Intelligenz in diesen digitalen Kameras, Gesichtserkennung und ähnliches, wenn man das weiterdenkt kann ich mir vorstellen, daß sich viel Automatisierung in Amateur-Stereokameras integrieren läßt. Wenn sich dann noch die Fotografen mit den Grundregeln auseinandersetzen und sie beachten, können schon sehr schöne Aufnahmen entstehen.
Egal wie sauber man beim Dreh die Kameras synchronisiert, bei 3D-Filmen macht man zusätzlich immer ein sogenanntes Sweetening in der Postproduktion, um auch noch die kleinsten Disparitäten zwischen den beiden Stereobildern zu entfernen, die ua. entstehen, weil selbst baugleiche Optiken nie identisch sind. Das müßte bei den fest montierten Dual-Linsenkameras folglich auch ein Problem sein?
Generell ist es richtig, daß kein Objektiv dem anderen gleicht. Egal, ob das hochwertigste Optiken sind, es gibt immer kleinste geometrische Abweichungen. So wurde zB. bei einer 24mm Optik festgestellt, da steht 24 auf dem Gehäuse, wenn man es aber nachmißt am Objektiv sind es beim einen 23mm und bei einem anderen 25,5. Das resultiert in Abweichungen vom Ideal zweier gleicher Bilder, die natürlich korrigert werden müssen, in der Postproduktion oder mit dem Stereographic Analyzer, der gerade im Live-Betrieb diese Korrekturen in Echtzeit machen muß. In der Postpro kann man sich eine Stunde hinsetzen, oder zwei, und die Unterschiede geometrisch anpassen, den Höhenversatz anpassen und so, aber im Live-Betrieb muß das sofort, 25mal pro Sekunde passieren. Das ist eine Herausforderung, aber da wird an entsprechenden Technologien gearbeitet. Für den Consumerbereich ist das genauso eine Herausforderung die gemeistert werden muß, wobei man natürlich schon bei der Fertigung darauf achten kann, daß Objektive von ähnlicher Güte verbaut werden, und danach viel über die Elektronik ausgeglichen wird.

3D im Kino – physikalische Grenzen, subjektive Wahrnehmung
Wie gesagt gibt es ja viele mögliche Fehlerquellen auf dem Weg des 3D-Bildes von der Aufnahme bis zum Publikum – die Qualität des wahrgenommenen Bildes hängt ja sogar davon ab, wo man im Kino sitzt. Wird man das denn alles unter Kontrolle bekommen?
Es wird Assistenzsysteme geben, die das unterstützen, aber klar, das kann so gut sein wie es will, wenn das Fachwissen nicht vorhanden ist beim Personal wird es immer möglich sein, durch eine Fehleinstellung ein 3D-Bild zu ruinieren. Man muß sich auch bewußt sein, daß es gewisse physikalische Grenzen gibt, die liegen in der Natur unserer Wahrnehmung, in optisch-physikalischen Gegebenheiten, die man nicht ändern kann. Dazu gehört sicherlich auch die unterschiedliche 3D-Wahrnehmung auf unterschiedlichen Positionen im Kino.
Es gibt durchaus Schwächen bei der Vorführung von 3D im Kino heute, die man technisch in den Griff bekommen kann. Dazu gehört zB. Ghosting, dh. das Überspringen von kontrastreichen Bildteilen vom linken Bild ins rechte und zurück, also die Überschneidung von Kontrasten in den beiden Bildern. Dieses Ghosting kann durch bessere Filtertechnologien, durch bessere Shuttertechnologien, durch bessere Leinwände usw, also aus einem Bündel an Maßnahmen verbessert werden. Aber gerade die Positionierung vor der Kinoleinwand, das ist eine physikalische Gegebenheit.
Sollte man dann nicht besser bei 3D-Vorführungen den Zuschauerbereich einschränken, damit Leute gar kein schlechtes 3D zu sehen bekommen können? Um zu vermeiden, daß aufgrund von eigentlich unnötigen Problemen nachher die Leute sagen, von 3D bekomme ich Kopfschmerzen, da geh ich nicht mehr rein...
Das war ja im IMAX-Kino so, da gab es Sitze, die wurden wirklich als für 3D nicht geeignet definiert. Das wird in Zukunft in den Kinos architektonisch berücksichtigt werden müssen, wie es IMAX vorgemacht hat. Da hat man praktisch von jedem Platz gut sehen können, die schwächeren Plätze waren nicht inakzeptabel schwach -- in diese Richtung wird sicher die Entwicklung gehen.
Sehen Sie auch eine Gefahr in der aktuellen Tendenz in Hollywood, 2D-Filme nachträglich in 3D umzuwandeln, oder überhaupt schnell in 3D zu produzieren?
Definitiv, das ist eine ganz große Gefahr, daß man dadurch die Begeisterung wieder erstickt, weil zuviele unerfahrene Filmemacher und Produzenten auf diesen Zug aufspringen, nicht über das nötige Fachwissen verfügen, nicht die richtige Technik einsetzen, sondern nur den schnellen Euro sehen. Da muß man auch ein bißchen auf die Filmkritik vertrauen, daß die sich weiterbilden und auch in der Lage sein werden, einen 3D-Effekt als solchen zu betrachten. Es gibt auch Diskussionen in Fachkreisen, über – salopp ausgedrückt – eine Art 3D-TÜV, ob es Bewertungskriterien dafür geben könnte.
So etwas ähnliches wie den Jugendschutz?
Ja, ich bin ja Mitglied in der Steering Group vom Innovationsforum des Multimediazentrums in Halle, die auch den FantaVier-Event veranstalten, und da laufen Diskussionen in diese Richtung. Wobei man eine schwierige Gratwanderung zu bewältigen hat zwischen einerseits einem technischen Standard, den man definiert, der aber auf der anderen Seite nicht die kreative Freiheit des Filmemachers beschneiden soll. Oft kann ja eine bewußt falsch eingesetzte, stereoskopische Einstellung dazu dienen, eine Irritation hervorrufen, die kreativ gewollt ist. Wie behandle ich das dann in meiner Prüftabelle? Wenn ich das jetzt übertragen würde auf den 2D-Film, da gibt es solche, die mit Unschärfen und Wackelbildern arbeiten -- Blair Witch Project hätte einen solchen Test nie bestanden, und das ist ja ein exzellenter Film. Also so ganz einfach ist das nicht.
Manchmal scheint es, als müsste man, um über 3D überhaupt sprechen zu können, eine Sprache erfinden für die vielen Arten von Effekten, oder 3D überhaupt. Wenn etwas schief läuft zum Beispiel kann man oft gar nicht genau definieren, was es war.
Ein Umstand von 3D ist ja, das soviel dabei in der subjektiven Wahrnehmung stattfindet. Das ist wirklich nicht ganz mit mathematisch oder technischen Systemen in den Griff zu bekommen. Zwei Beispiele dazu: ich erlebe sehr oft bei Vorführungen, daß die Bilder für linkes und rechtes Auge vertauscht sind. Das sehen sich unbedarfte Leute an, und finden es irgendwie komisch, aber können es nicht benennen. Es ist ja immer noch 3D, aber alles was hinten sein soll ist vorne und was vorn sein soll ist hinten. Es wird ein Fehler wahrgenommen, aber dieser kann nicht definiert werden, dann kommt es manchmal zum Urteil: das soll halt so sein, aber es gefällt mir nicht wirklich.
Das andere Beispiel, von dem man sich erzählt, daß es tatsächlich passiert ist in einem Kino, als Avatar vorgeführt wurde. Das Publikum hat den Film angeguckt -- wunderbar, alle gingen begeistert raus. Nachher hat sich herausgestellt, in der Vorführtechnik war 3D gar nicht aktiv. Dh. alleine mit einer Brille vor der Leinwand zu sitzen, kann für einen 3D-Effekt ausreichen. Gut, das ist ein Gerücht -- ich kann mir aber vorstellen, daß es stimmt, denn wir haben auch schon besonders in Sequenzen, in denen sehr schnelle Bewegungen vorkamen, ein-zwei Einstellungen in 2D reingeschnitten, weil sich Geschwindigkeit und 3D oft feindlich gegenüberstehen können. Da arbeitet man dann auch mit der subjektiven Wahrnehmung und mit dem Interpolieren des Effekts. Ich bin mir sicher, wenn ich Ihnen eine Abfolge von 10 Szenen zeige, davon sind die ersten 7 in 3D, dann kommt eine in 2D, und dann wieder zwei in 3D, Sie würden das nicht wirklich rausfinden.
Von der 2D-Filmgestaltung zu 3D
Es heißt ja auch, daß es einen Gewöhnungseffekt gibt, wenn man viel mit 3D arbeitet. Das Gehirn gewöhnt sich daran, diese Bilder zu interpretieren, was dazu führt, daß man den Effekt unter Umständen unbewußt immer stärker einsetzt.
Das stimmt, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Sitzt man zwei, drei Tage intensiv im Schnitt dabei, möchte man den 3D-Effekt anziehen und stärker machen, weil man sich an den Effekt gewöhnt. 3D bringt uns ja die Filmbilder näher an die Realität, dadurch gibt es einen schnellen Adaptionsprozess des Gehirns an diese neue Art der Filmdarstellung. Das merkt man ja auch schon wenn man sich einen Spielfilm in 3D anschaut. In den ersten 30, 40 Minuten ist 3D als räumlicher Effekt wahrnehmbar bzw. wird als solcher empfunden, in der zweiten Hälfte des Films wird es dann meist schon zu einer Normalität. Das ist wie mit der Umstellung von Schwarz/weiss auf Farbe. Irgendwann war Farbe, weil es der Natur entspricht, keine Sensation mehr. Aber, und da kommen wir zu der großen Aufgabe, die wir Filmemacher haben, wie wir mit Farbe ein neues Gestaltungsmittel kreiert haben, als dramaturgisches Element, als ein Element der Geschichtenerzählung, als Element der Emotionalisierung von Szenen, genauso müssen wir den Raumeindruck dramaturgisch nutzen. Ihn wie etwa die Musik auch einsetzen, mal den Effekt bewußt reduzieren, um ihn dann ganz gezielt in den Vordergrund zu stellen, damit er die Erzählung unterstützt.

Müsste man nicht sogar anfangen, die Bilder ganz anders zu kadrieren und zu gestalten? Vieles der 2D-Filmgestaltung ist ja darauf ausgelegt, eine Tiefe im Raum aufzumachen, und wenn dieser sich jetzt von alleine aufstaffelt mit der 3D-Technik, könnte man sich doch Mittel wie Bildachsen oder das Modellieren mit Licht sparen, und neue Mittel finden, um den 3D-Raum angemessen darzustellen?
Also, daß man sich sparen kann, was im 2D-Film den Raum modelliert, das glaube ich nicht, denn das unterstützt alles. Wir haben ja gelernt, in der flachen 2D-Leinwand den Raum zu simulieren mit all diesen monokularen Tiefeneindrücken, die es gibt: Überschneidungen, Licht und Schatten, die Perspektive, die atmosphärische Tiefenwirkung beim Landschaftsdreh, die Motion Parallaxe, also die Verschiebung der Objekte, wenn ich eine Kamerafahrt mache. All das ist ein gelerntes Instrumentarium, um als Workaround im 2D-Film 3D herzustellen. Das geht mir ja erstmal nicht verloren im 3D-Film. Wir haben aber zusätzlich das Instrument der stereoskopischen Darstellung, das was beim Auge auch passiert, wenn es einen Raum betrachtet durch den Augenabstand, nämlich die Wahrnehmung auf Grund von Disparitäten, von Verschiebungen der unterschiedlichen Objekte auf der horizontalen Ebene. Dieser stereoskopische Bildeindruck in Verbindung mit den monokularen Tiefenhinweisen zusammen ergibt ein gutes 3D-Bild. Wo man aufpassen muß, daß man das 3D-Bild nicht zerstört, das ist wenn die monokularen und die binokularen Tiefenhinweise kollidieren.
Wie beziehungsweise wann kann das passieren?
Da ist das beste Beispiel die Border-Violation, bei der Objekte aus der Leinwand herausragen, die gar nicht herausragen können. Wenn ein Luftballon in den Raum hereinfliegt dann muß er durch das Fenster durchpassen. Wenn ich den Ballon jetzt aber anschneide an der Seite, dann gibt es genau diese Diskrepanz. Dann habe ich einen monokularen Tiefeneindruck, nämlich einen angeschnittenen Luftballon, der sagt mir: dieses Objekt ist hinter dem Fenster. Ich habe aber auch einen stereoskopischen Bildeindruck aufgrund der Verschiebung der Parallaxe des Objekts, der sagt: negative Parallaxe, der Ballon ist im Raum. Somit kollidieren die Eindrücke, und es gibt ein schlechtes 3D-Bild -- man wird verwirrt, etwas stimmt nicht, aber man kann es nicht benennen.
Daran muß man also als Filmemacher arbeiten, daß man aus dem Instrumentarium übernimmt, was in beiden Welten funktioniert. Nehmen Sie auch das Beispiel mit der Unschärfe, etwa die unscharfen Zweige im Vordergrund, durch die man durchblickt. Das funktioniert in 2D wunderbar, man hat ja alles auf einer Ebene, und auf die fokussiert man, nämlich auf die Leinwandebene. Im 3D-Film aber kann ich mich tatsächlich physikalisch im 3D-Bild umgucken, wenn ich auf Objekte vor, hinter oder auf der Leinwand konvergiere mit den Augen. Und wenn ich auf etwas konvergiere, dann erwarte ich von meiner Seherfahrung her, daß dieses Objekt scharf wird. Jetzt ist aber etwas ganz vorne im Vordergrund, stereoskopisch ganz nah platziert, ich gucke drauf, und es bleibt unscharf. Das gibt es nicht im natürlichem Sehen, und deshalb bin ich irritiert, und deshalb funktioniert das im 3D-Film nicht.
Ich kann aber natürlich mit einem unscharfen Hintergrund arbeiten, wenn eine Person zB. aus dem Bett hochschreckt und das Gesicht präsent vor mir erscheint -- dann ist es völlig egal, ob die Wand im Hintergrund scharf ist oder nicht. Ich bin so auf das erschrockene Gesicht fixiert, daß ich mich gar nicht im Raum umgucken will. Wenn ich aber ein langsame Kamerafahrt habe durch ein Wohnzimmer, da hinten prasselt das Kaminfeuer, vorne steht eine Whiskeyflasche auf dem Tisch, und es dauert sehr lang, dann will ich mich natürlich umgucken können...
Dann hätte man weniger Kontrolle über den Zuschauerblick als 3D-Filmemacher, er läßt sich nicht so lenken, weil der Zuschauer ja verleitet wird, selber im Raum sich umzusehen.
Man muß in der Inszenierung die Blicklenkung präziser erarbeiten, das ist aber genauso möglich. Wir haben oft in Bildübergängen einen Reflex eingefügt, um den Blick dorthin zu lenken, oder woanders einen Reflex weggenommen, weil er irritiert hat. Das ist schon diffiziler, aber machbar. Und man hat auch Ton natürlich -- ich kann irgendwo ein Tonereignis im Bild verankern und den Blick dorthin lenken.
Das ist aber eigentlich auch sehr spannend, wie sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein völlig neuer Raum öffnet für Filmemacher, mit dem man erst einmal lernen muß, umzugehen. Ein bißchen wie mit dem Tonfilm, da dauerte es ja auch eine ganze Weile, bis man den Ton wirklich sinnvoll eingesetzt hat.
Ja. Ich habe übrigens mal die Argumente verglichen, die gegen den Tonfilm verwendet wurden, mit den Argumenten, die man heute teilweise liest gegen 3D. Das ist zum Teil dieselbe Wortwahl. Also: der Zuschauer wird die Schnitte nicht mitverfolgen können, der Zuschauer wird nicht wissen, wie er sich im Raum orientieren soll, weil ihn die Tonereignisse verwirren usw. Das hatte ich als Einführung bei einem Vortrag verwendet, nach dem Motto, es gibt jede Menge Argumente gegen 3D, ich nenne Ihnen mal die wichtigsten -- das waren 5 Argumente und alle Zuschauer nickten zustimmend, und waren dann entsprechend verblüfft zu hören, daß die Argumente aus den 30ern stammten gegen den Tonfilm.
Ich erlebe das auch bei vielen Regisseuren, diese Scheu sich auf Neuland zu bewegen, und das, was man über Jahrzehnte gelernt hat, was man auch als persönliches Stilmittel entwickelt hat, dessen plötzlich beraubt zu sein. Das ist sicher auch ein kritischer Punkt.
Keiner sagt gerne: ich bin jetzt nach 30 Jahren Filmerfahrung wieder Anfänger...
Ja, das kostet Überwindung. Aber ich finde, wir sind hier in einem kreativen Beruf, da geht es auch um Innovation, um Lust und Neugier aufs Neue, und wer sich die nicht mehr bewahrt hat, ist nur noch Reproduzent seiner alt-eingesessenen Stilmittel...

Wim Wender macht ja gerade den Film über Pina Bausch in 3D. Waren Sie da zufällig auch beteiligt?
Beteiligt nein, er hat das mit französischen Stereographern gemacht, aber ich habe Ausschnitte gesehen, die mich sehr überzeugt haben -- ich glaube, das ist ein spannendes Projekt, weil es das erste mal auch den Arthouse-Film mit 3D verknüpft, bis jetzt waren es ja immer Cartoons, Animationen, Blockbuster, dabei hat 3D durchaus auch im Arthouse-Film und anderen Sparten abseits des Blockbusters seine Berechtigung.
Aber man kann sich fragen, in welchen Kinos das laufen soll, denn Programm-Kinos haben ja noch großteils kein 3D und die Multiplexe orientieren sich nicht am Arthouse-Publikum.
Das ist momentan ein Problem, ja -- wenn auch ein Übergangsproblem, weil ja viele Kinos nach und nach 3D-fähig werden. Ich denke aber, wenn er das gezielt lanciert könnte es klappen, denn ein grundsätzlicher Bedarf an 3D ist gegeben, und das ein oder andere Multiplex wird dann wohl sagen, wir nehmen den Wenders-Film jetzt doch ins Programm, der ist in 3D und da gibt es entsprechendes Interesse..
Zum Abschluß noch ein Wort zu Avatar -- Cameron hatte da ja Ansprüche, nicht nur Sensationskino zu machen, sondern wirklich auch die Technik weiterzuentwickeln. Ist das Ihrer Meinung nach gelungen?
Also gelungen an Avatar war, daß er so viel Aufmerksamkeit auf sich und das Thema gezogen hat, und daß er auch Skeptiker davon überzeugt hat, daß 3D nicht mehr nur ein Nischenphänomen ist, sondern zu einem ernstzunehmenden, neuen Format geworden ist. Das hat Avatar geschafft, aber einen neuen 3D-Qualitätsstandard hat Avatar meiner Meinung nach nicht gesetzt. Natürlich schon im Hinblick auf den enormen Aufwand, mit dem er produziert wurde, und technologisch haben sie sicherlich sehr viel entwickelt, um die Verknüpfung von Realszenen mit virtuellen Welten zu generieren, und so ist es eine technologische Meßlatte geworden. Kreativ hat er mich nicht überzeugt, das Storytelling ist ja doch sehr konventionell. Stereoskopisch ist er generell gelungen, die ein oder andere Schwäche entdeckt man, wenn man ihn analysiert, aber das ist ja systemimmanent bei so einem Riesenprojekt mit so vielen Beteiligten.
Aber ein Neu-Anfangspunkt für 3D war es schon.
Ja, wir haben natürlich gemerkt seit Avatar, daß das Telefon plötzlich nicht mehr still stand. Alle, denen man jahrelang erzählt hat, das ist das Format der Zukunft, haben immer nur müde gelächelt, und nun wurde selbst im hintersten Eck wahrgenommen, das ist was Neues, das Leute faszinieren und ins Kino bringen kann. Insofern ist es das große Verdienst von Avatar, ein Eisbrecher gewesen zu sein.
Klingt wie ein gutes Schlußwort... Herr Kluger, vielen Dank für das nette Gespräch!
Bildmaterial mit freundlicher Genehmigung der KUK Filmproduktion GmbH